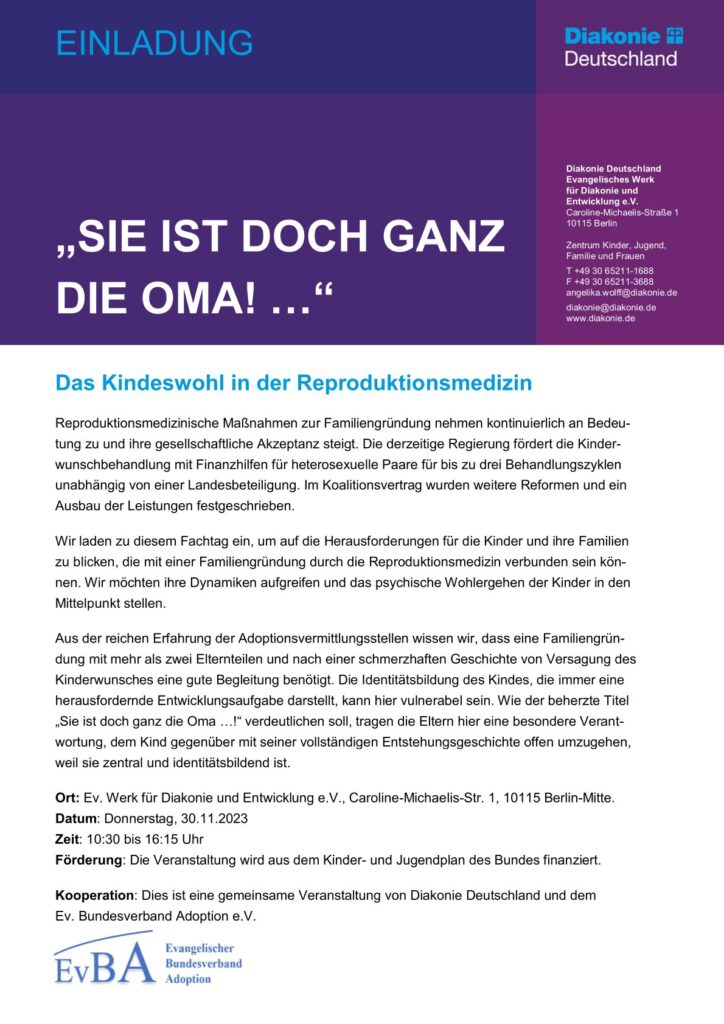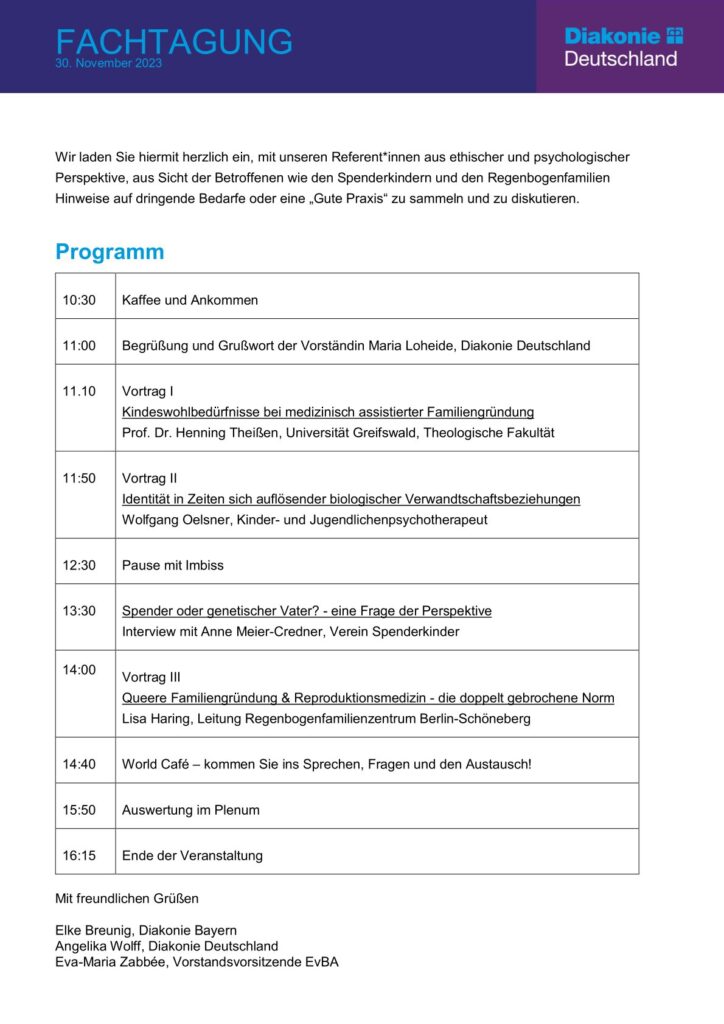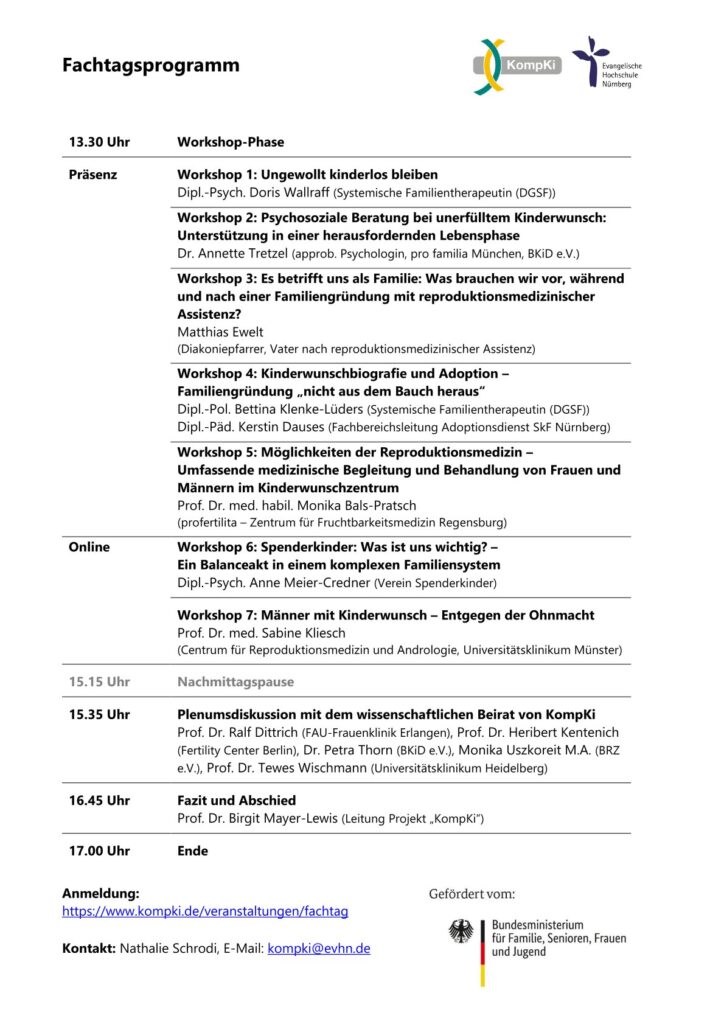Am 16 Januar hat das Bundesministerium der Justiz zwei Eckpunktepapiere zur Modernisierung des Familienrechts veröffentlicht: ein Eckpunktepapier zur Reform des Kindschaftsrechts mit Vorschlägen für neue Regeln im Sorge-, Umgangs- und Adoptionsrecht sowie ein Eckpunktepapier zur Reform des Abstammungsrechts.
Der Verein Spenderkinder bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu den Eckpunkten des Bundesministeriums für Justiz.
I. Der Verein Spenderkinder
Der Verein Spenderkinder vertritt die Interessen von durch Samen“spende“ (im Folgenden Samenvermittlung) gezeugten Menschen in Deutschland. Dabei repräsentiert er die Sicht der entstandenen Kinder auf Samenvermittlung und andere Formen der Familiengründung mit den Geschlechtszellen einer dritten Person wie Eizellvermittlung, Embryonenvermittlung und Leihmutterschaft. Zu den Zielen gehört insbesondere, andere Spenderkinder, Menschen mit Kinderwunsch und Menschen, die ihre Keimzellen abgeben, über die rechtlichen Rahmenbedingungen und psychologischen Herausforderungen dieser Arten der Familiengründung sowie über den aus Sicht des Vereins bestehenden rechtlichen Handlungsbedarf zu informieren.
II. Zusammenfassende Positionierung des Vereins Spenderkinder zu den Eckpunkten des Bundesministeriums der Justiz für eine Reform des Abstammungsrechts und des Kindschaftsrechts
Der Verein Spenderkinder begrüßt viele der
vorgesehenen Eckpunkte für eine Reform des Abstammungs- und Kindschaftsrechts.
So unterstützt der Verein Spenderkinder, dass Kinder von Eltern in
homosexueller Ehe von Anfang an zwei rechtliche Elternteile haben, damit ihre
Versorgung genauso gut abgesichert ist, wie die von Kindern, deren Eltern in
heterosexueller Ehe leben. Vor demselben Hintergrund unterstützt der Verein
Spenderkinder die Möglichkeit, Kindern durch eine Elternschaftsvereinbarung
bereits präkonzeptionell einen zweiten Elternteil zuzuordnen.
Der Verein Spenderkinder begrüßt alle Bestrebungen,
um das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung effektiv zu sichern. Dazu
gehört ein Vermerk im Geburtenregister, wenn eine Elternschaftsvereinbarung
getroffen wurde oder ein Kind durch ärztliche Keimzellvermittlung entstanden
ist. Auf diese Weise stellt das Kind spätestens bei einer Anmeldung zur
Eheschließung fest, dass weitere Informationen zu seiner Abstammung vorliegen,
und nur so ist es Behörden möglich, effektiv zu prüfen, ob Ehehindernisse, wie
eine zu nahe Verwandtschaft, bestehen. Ebenfalls zur Sicherung des Rechts auf
Kenntnis der Abstammung gehört die Erweiterung des Samenspenderregisters um
Daten zu Embryonenvermittlungen und um Daten aus ärztlicher Samenvermittlung
vor 2018. Auch die Möglichkeit, die leibliche Abstammung mit einem mutmaßlichen
leiblichen Elternteil gerichtlich feststellen zu lassen, ohne dazu wie bisher
die rechtliche Vaterschaft anfechten zu müssen, ist ein wichtiger Schritt. Er
ermöglicht es dem Kind, sein Recht auf Kenntnis der Abstammung wahrzunehmen, ohne
dabei eine möglicherweise bestehende rechtliche Elternschaft zu dem zweiten
Elternteil auflösen zu müssen.
Ferner begrüßt der Verein Spenderkinder das
Umgangsrecht des Kindes mit seinen leiblichen Elternteilen als wichtiges
Signal, dass das Kind Bedürfnisse entwickeln kann, die von den ursprünglichen
Vereinbarungen seiner Elternteile abweichen. Zwar kann das Kind sein Recht auf
Umgang mit einem leiblichen Elternteil in der Praxis nur dann wahrnehmen, wenn
der leibliche Elternteil dazu bereit ist; möglicherweise ist der leibliche
Elternteil aber dazu bereit, wenn er erfährt, dass das Kind Umgang wünscht,
auch wenn er initial darauf verzichtet hat.
Kritisch sieht der Verein Spenderkinder, dass dem
Kind die Möglichkeit genommen werden soll, die Zuordnung zu den rechtlichen
Eltern anzufechten. Es dient gerade nicht dem Schutz der Rechte und Interessen
des Kindes, ihm die bestehende Anfechtungsmöglichkeit seiner Zuordnung zu einem
nicht genetisch verwandten Elternteil zu erschweren oder die Frist dazu zu
verkürzen.
Ebenfalls nicht im Sinne des Kindes sind
Elternschaftsvereinbarungen, bei denen ein genetischer Elternteil seine
elterliche Verantwortung für das Kind abgibt, ohne dass ein zweiter rechtlicher
Elternteil vorgesehen ist, der sie übernehmen möchte. Dies ist regelhaft bei
Kindern von sogenannten Solo-Müttern der Fall. Gleichfalls dient es nicht der
Absicherung des Kindes, wenn der rechtliche Elternteil neben der Geburtsmutter
vereinfacht seine rechtliche Elternschaft ablegen kann, ohne dass eine andere
Person als zweiter rechtlicher Elternteil des Kindes festgestellt wird.
An diesen Punkten zeigt sich, wie die Eckpunkte
teilweise versuchen, die Wünsche von (Wunsch-)eltern auf Kosten der Rechte des
Kindes abzusichern.
Stattdessen muss die Zuordnung der Elternschaft
durch Ehe oder kraft Anerkennung – wie bisher auch – bei fehlender genetischer
Verbindung durch das Kind anfechtbar bleiben. Ergänzend ist es erforderlich,
dass das Kind die Mutterschaft der Geburtsmutter anfechten kann, wenn sie mit
dem Kind nicht genetisch verwandt ist.
Zudem haben Kinder ein Recht auf zwei Elternteile.
Daher sollte bei der Ausgestaltung der Reformideen darauf geachtet werden, dass
allen Kindern ein zweiter rechtlicher Elternteil zugeordnet wird.
Weitere Ergänzungen sind notwendig, um das Recht
des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung effektiv zu sichern: Die relevanten
Daten müssen im erweiterten Samenspenderregister nicht optional, sondern
verpflichtend hinterlegt werden. Bei Spenderkindern, die vor 2018 gezeugt
worden sind, muss alles Erforderliche getan werden, um zu ermitteln, ob die
Daten über den genetischen Vater noch vorhanden sind. Die Samen vermittelnden
Ärzt:innen und Kliniken sollten hier zu einer Zusammenarbeit mit der
zuständigen Behörde verpflichtet werden. Auch Daten aus Keimzellvermittlung und
Leihmutterschaft, die im Ausland durchgeführt worden sind, sollten wenn möglich
im Spenderdatenregister aufgenommen werden. Auch
reicht es nicht aus, dass die Daten für das Kind zugänglich sind, sondern das
Kind muss aktiv in die Lage versetzt werden, von seinem Recht Gebrauch zu
machen. Dazu sollten die rechtlichen Eltern verpflichtet werden, ihre Kinder
über deren Abstammung aufzuklären.
Dem Recht auf Umgang mit Halbgeschwistern folgend, sollte das Samenspenderregister zudem nicht identifizierende Informationen über Halbgeschwister bereitstellen sowie bei gegenseitigem Interesse Daten für eine Kontaktaufnahme vermitteln.
III. Im Einzelnen zu den Eckpunkten für eine Reform des Abstammungsrechts
1. Die Zuordnung der Elternschaft durch Ehe oder kraft Anerkennung muss bei fehlender genetischer Verbindung durch das Kind anfechtbar bleiben, unabhängig vom Bestehen einer sozial-familiären Beziehung
Vorgesehen
ist, dass das Kind die Elternschaft der Person, die sich ihm durch eine
Elternschaftsvereinbarung zugeordnet hat oder in die medizinisch unterstützte Befruchtung
der Geburtsmutter mittels einer Samenspende eines Dritten eingewilligt hat,
regulär nicht anfechten kann und dass es die Elternschaft des nicht genetischen
Elternteils kraft Ehe oder Anerkennung nur dann erfolgreich anfechten kann,
wenn keine sozial-familiäre Beziehung zu ihm besteht (Eckpunkte
Abstammungsrecht, S. 12). Eine sozial-familiäre Beziehung wird vermutet, wenn
eine Ehe zwischen der Mutter und dem Mann besteht (§ 1600 Abs. 3 Satz 2 BGB). Das
ist nicht im Interesse des Kindes.
Welche
Bedeutung der weitere genetische Elternteil für das Kind hat, kann nur das Kind
selbst entscheiden. Unter Umständen hat das Kind ein Interesse daran, dass ihm
der zweite genetische Elternteil auch rechtlich zugeordnet wird. Es ist
nachvollziehbar, dass sich Wunscheltern ihre Elternstellung absichern möchten.
Hier dürfen jedoch nicht allein die Interessen der Wunscheltern ausschlaggebend
sein. Das Kind muss weiterhin für eine gewisse Zeit ab der Volljährigkeit bzw.
ab Kenntnis seiner Entstehungsweise, eine Möglichkeit zur Anfechtung von
Elternschaft haben, wenn es mit dem ihm zugeordneten Elternteil nicht genetisch
verwandt ist, unabhängig von einem sozial-familiären Miteinander im Alltag. Bei
der Anfechtungsmöglichkeit geht es nicht darum, soziale oder
Versorgungsbeziehungen abzubilden, sondern darum, die Autonomie des
(erwachsengewordenen) Kindes zu wahren, nicht gegen seinen Wunsch einem anderen
Menschen allein auf dessen Wunsch als Kind zugeordnet zu sein. Das Recht auf
Kenntnis der eigenen Abstammung umfasst nicht nur das Wissen darüber, von wem
ein Mensch abstammt, sondern beinhaltet auch die rechtliche Abbildung der
tatsächlichen biologischen Abstammungsverhältnisse.
Ferner gehen die Eckpunkte für eine Reform des Abstammungsrechts davon aus, dass Personen, die elterliche Verantwortung tragen, ein Kind regelhaft zu dessen Wohl pflegen und erziehen. Dies entbehrt völlig der Lebenserfahrung und ist geradezu zynisch gegenüber der Erfahrung von Spenderkindern, die – genau wie andere Kinder auch – alle Formen sozialer bzw. rechtlicher Eltern erleben. Der Wunsch, rechtlicher Elternteil zu werden, oder allein die Tatsache, mit der Geburtsmutter eines Kindes verheiratet zu sein, erlaubt keinen Rückschluss auf die grundsätzlichen oder sogar spezifischen Elternqualitäten eines Menschen gegenüber einem anderen. Die Möglichkeit des Kindes, sich aus einer willkürlichen Zuordnung nach den Wünschen der Eltern zu einem rechtlichen, aber nicht genetischen Elternteil durch Anfechtung zu lösen, muss wie bisher erhalten bleiben.
2.
Elternschaftsvereinbarungen, bei denen niemand die zweite Elternstelle
übernehmen soll, sind nicht im Interesse des Kindes – Kinder haben ein Recht
auf zwei Elternteile
Durch
Elternschaftsvereinbarungen soll künftig vor Zeugung eines Kindes
rechtsverbindlich vereinbart werden können, welche Person neben der
Geburtsmutter zweiter rechtlicher Elternteil eines Kindes wird.
Schon in
der Vergangenheit hatte sich der Verein Spenderkinder für die Möglichkeit einer
solchen präkonzeptionellen Elternschaftsvereinbarung eingesetzt, damit Kinder,
die nicht in eine heterosexuelle Ehe geboren werden, materiell genauso gut
abgesichert sind, wie Kinder in heterosexuellen Ehen, und von Beginn an zwei
rechtliche Eltern haben.
Nach wie vor schlechter gestellt sind jedoch Kinder, bei denen die Geburtsmutter wünscht, dass neben ihr niemand die zweite rechtliche Elternstelle übernimmt. Zusammen mit dem Samenspenderregistergesetz wurde eingeführt, dass ein Mann, der Samen über eine Samenbank abgegeben hat, nicht als rechtlicher Vater festgestellt werden kann (§ 1600d Absatz 4 BGB). Bereits diese Regelung sieht der Verein Spenderkinder sehr kritisch, weil er durch ärztliche Samenvermittlung gezeugte Personen zu Menschen zweiter Klasse macht, die ihren genetischen Vater nicht offiziell als rechtlichen Vater feststellen lassen können. Begründet wurde dieser Ausschluss damit, dass regelmäßig der intendierte Vater die zweite rechtliche Elternstelle besetzen wolle. Als Folge vermitteln Samenbanken in Deutschland jedoch Samen an alleinstehende Personen. Die so gezeugten Kinder haben keinen zweiten rechtlichen Elternteil.
Die
Eckpunkte für eine Reform des Abstammungsrechts sehen außerdem vor, dass der
kraft Ehe mit der Geburtsmutter rechtliche Elternteil sich vereinfacht aus
seiner rechtlichen Elternschaft lösen können soll, wenn er nicht genetischer
Elternteil des Kindes ist und nicht mittels Elternschaftsvereinbarung oder
Einwilligung in eine Befruchtung mit dem Samen einer dritten Person der Zeugung
des Kindes zugestimmt hat. Das Kind hat dadurch nur noch einen rechtlichen
Elternteil.
Kinder, auch Spenderkinder, haben ein grundsätzliches Recht auf zwei rechtliche Elternteile und dass die Feststellung eines genetischen Elternteils als rechtlicher Elternteil nicht von vornherein rechtlich ausgeschlossen wird. Auch das Bundesverfassungsgericht führt aus, dass es ein Interesse des Kindes geben kann, „seinen leiblichen Vater nicht nur zu kennen, sondern ihn auch als Vater rechtlich zugeordnet zu erhalten“. Dieser Gesichtspunkt wurde bei § 1600d Absatz 4 BGB ignoriert – was zeigt, wie sehr sich der Diskurs im Abstammungsrecht an Elternwünschen orientiert. Es sollte bei dem Grundsatz bleiben, dass Menschen für die Kinder verantwortlich sind, die sie zeugen, egal ob innerhalb oder außerhalb einer Ehe.
Bei der Ausgestaltung der Reformvorschläge sollte daher darauf geachtet werden, dass Kindern auf jeden Fall ein zweiter rechtlicher Elternteil zugeordnet wird.
3.
Die Frist zur Anfechtung durch das Kind muss weiterhin mindestens zwei Jahre
betragen
Der Verein
Spenderkinder begrüßt es, dass die Anfechtungsfrist für heranwachsende
Spenderkinder nicht vor Vollendung ihres 21. Lebensjahres enden soll. Ansonsten
ist vorgesehen, die Frist zur Anfechtung der Vaterschaft bzw. Elternschaft für
erwachsene Spenderkinder auf ein Jahr zu verkürzen. Dies ist nicht im Interesse
des Kindes.
Auf Seiten
des Kindes gibt es keinen Grund, die bestehende Anfechtungsfrist von zwei
Jahren durch das Kind zu verkürzen. Dieser Zeitraum ist bereits sehr kurz,
bedenkt man den Loyalitätskonflikt, den viele Spenderkinder spüren, wenn sie
ihren eigenen Bedürfnissen nachgehen möchten, die von denen ihrer Eltern
abweichen. Nach wie vor erfahren viele Spenderkinder erst im fortgeschrittenen
Erwachsenenalter von ihrer Entstehungsweise, teilweise unter sehr ungünstigen
Umständen, z.B. indem ihnen DNA-Datenbanken Halbgeschwister anzeigen oder weil
sie durch Krankheit oder Tod ihrer rechtlichen Eltern von deren
Krankheitsgeschichte oder Blutgruppe erfahren, die eine leibliche
Verwandtschaft ausschließen. Viele solch spät aufgeklärter Spenderkinder
benötigen einige Zeit, um sich neu zu orientieren. Die vorgesehene Verlängerung
der bisherigen Anfechtungsfrist für heranwachsende Spenderkinder wird damit
begründet, dass sie vor einer übereilten Entscheidung geschützt werden sollen.
Dieses Argument lässt sich übertragen auf Spenderkinder, die im
Erwachsenenalter von ihrer Entstehungsweise erfahren. Die Frist zur Anfechtung
muss daher weiterhin mindestens zwei Jahre betragen.
4.
Anfechtung der Elternschaft der Geburtsmutter ermöglichen
Vorgesehen
ist, dass das Kind künftig nicht nur wie bislang die Vaterschaft des
rechtlichen Vaters anfechten kann, wenn dieser mit ihm genetisch nicht verwandt
ist, sondern auch die Mutterschaft der rechtlichen Mutter neben der
Geburtsmutter.
Seit
einigen Jahren finden in Deutschland jedoch auch Embryonenvermittlungen statt
und Kinder werden nach Eizell- oder Embryonenvermittlung im Ausland in
Deutschland geboren. Dadurch ist die austragende Person nicht mehr automatisch
die genetische Mutter. Folglich sollte das Kind die Möglichkeit erhalten, auch
die Mutterschaft der Geburtsmutter anzufechren, wenn es nicht genetisch
verwandt mit ihr ist.
5.
Erweiterung des Samenspenderregisters auch für Embryonenvermittlungen und
„Leihmütter“ aus dem Ausland und verpflichtende Übernahme von Daten aus
ärztlicher Samenvermittlung ab 1970
Vorgesehen
ist, dass das Samenspenderregister, das bisher nur Daten zu ärztlicher
Samenvermittlung im Inland ab 1. Juli 2018 erfasst, ausgebaut wird und künftig als
Spenderdatenregister auch Daten über ärztliche Samenvermittlung aus der Zeit
vor dem 1. Juli 2018 sowie private Samenvermittlung, Embryonenvermittlung und
im Ausland durchgeführte Eizellvermittlung erfassen kann.
Der Verein Spenderkinder begrüßt diese Erweiterung. Um das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung effektiv zu sichern, ist es notwendig, dass diese Daten nicht nur optional sondern verpflichtend beim Spenderdatenregister hinterlegt werden. Hier kommt es auch entscheidend darauf an, dass die Keimzellen vermittelnden Ärzt:innen sowie Kliniken zu einer Zusammenarbeit aufgefordert werden und die vorhandenen Daten weiterleiten. Zusätzlich sollten Daten über die genetischen Elternteile bei Embryonen- oder Keimzellvermittlung im Ausland und die Identität der austragenden Person von im Ausland durchgeführten Leihmutterschaften wenn möglich im Spenderdatenregister aufgenommen werden. Für Menschen, die vor dem Inkrafttreten des Samenspenderregistergesetzes am 1. Juli 2018 gezeugt wurden, sollten die bei Ärzt:innen und Kliniken oder privaten Notar:innen noch vorhandenen Daten der genetischen Elternteile an das Spenderdatenregister übertragen werden, ohne dass es dabei auf das Einverständnis der genetischen Elternteile ankommt. Die Bundesärztekammer wies bereits mit Zulassung der ärztlichen Samenvermittlung im Jahr 1970 auf das unverzichtbare Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung hin und machte explizit, dass Ärzte die Identität des „Spenders“ nicht verschweigen dürfen. Dies war Reproduktionsmedizinern auch bekannt. Da insbesondere Spenderkinder, die bis Mitte der 1990er Jahre gezeugt wurden, häufig auf wenig Kooperationsbereitschaft bei den zuständigen Ärzt:innen und Kliniken treffen, wären ergänzend konkrete Maßnahmen umzusetzen, die Reproduktionsmediziner:innen und Kliniken in die Pflicht nehmen, dass sie Unterlagen von vor 2018 auch tatsächlich an das Register übergeben.
IV. Im Einzelnen zu den Eckpunkten für eine Reform des Kindschaftsrechts
1. Recht auf Umgang mit Halbgeschwistern
Die Eckpunkte für eine Reform des Kindschaftsrechts erinnern daran, dass Kinder ein Recht auf Umgang mit ihren Geschwistern haben.
Der Verein Spenderkinder begrüßt diesen Hinweis. Viele Spenderkinder wünschen sich Informationen über ihre Halbgeschwister, z.B. wie viele sie insgesamt haben und erleben Kontakt zu ihnen als bereichernd.. Das Samenspenderregister sollte daher grundsätzlich auch Auskunft über nicht identifizierende Informationen wie z. B. die Anzahl und die Geburtsjahre geben und bei gegenseitiger Einwilligung der betroffenen Personen auch Daten zur Kontaktaufnahme vermitteln.
2. Spenderkinder müssen in die Lage versetzt
werden, ihr Recht auf Kenntnis ihrer Abstammung geltend zu machen
Der
Verein Spenderkinder begrüßt, dass die Eckpunkte für eine Reform des
Kindschaftsrechts vorsehen, dass ein Kind einen einfachen Anspruch auf
Informationen über seine Abstammung gegen seine Eltern geltend machen kann, um
das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung besser als bisher zu
schützen.
Dieser Auskunftsanspruch bringt jedoch wenig, wenn eine Person nicht weiß, dass sie durch Samenvermittlung gezeugt wurde. Nach einer Meta-Analyse aus dem Jahr 2016 wissen nur etwa 20 % der Spenderkinder von ihrer Zeugungsart. Das Recht auf Kenntnis der Abstammung zu sichern, bedeutet auch, dass die Inhaber dieses Rechts in die Lage versetzt werden, ihr Recht effektiv auszuüben. Das ist auch wichtig in Bezug auf mögliche vererbte Gesundheitsrisiken und mögliche Ehehindernisse durch zu nahe genetische Verwandtschaft. Um das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung effektiv zu sichern, muss daher klargestellt werden, dass rechtliche Eltern als Teil ihrer sorgerechtlichen Verpflichtung verpflichtet sind, ihre Kinder über deren Abstammung aufzuklären und ihnen entsprechende Auskünfte zu geben. Das würde auch für Adoptierte und so genannte „Kuckuckskinder“ gelten. Da sich das Befolgen einer solchen Verpflichtung nicht überprüfen lässt, wären ergänzend weitere konkrete Maßnahmen notwendig, die gewährleisten, dass Kinder mit hoher Wahrscheinlichkeit von ihrer Entstehungsweise erfahren.